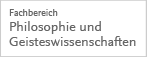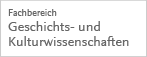Rede von Yevgenia Belorusets
Wer darf sprechen
Yevgenia Belorusets
Als ich diesen Text zu schreiben begann, sahen die Straßen neben meinem Haus in Berlin gedämpft aus.
Ich versuchte vergebens meine Freunde und Verwandte anzurufen, immer wieder gibt es in Kiew für Stunden kein Licht, keine Heizung und kein Wasser. Seit 10 Oktober, mehrere Wochen nacheinander, wird in vielen Städten der Ukraine wieder und wieder die kritische Infrastruktur angegriffen.
Angesichts von Russlands Terror, der Verwundeten, Toten, Frierenden Ukrainern, angesichts des ständiges Unrechts und der genozidalen Verbrechen ist es besonders schwer über die sogenannte „Kulturfront“ zu schreiben, aber ich möchte doch einen ersten Schritt in diese Richtung unternehmen.
Seit dem Anfang des Krieges bin ich Augenzeugin von unterschiedlichen Vorschlägen, die an ‚die Anderen‘ gerichtet werden: sie sollen aus der Sichtbarkeit verschwinden, im Schweigen untertauchen. In den ersten Wochen des Krieges wurde ein Vorschlag dieser Art an etwas so Unklares gerichtet, wie die „russische kulturelle Gemeinschaft“. Ich erinnere mich an die geschriebenen und ausgesprochenen Aussagen, die im Namen der Opfer aufriefen, nicht mehr öffentlich aufzutreten, über das eigene Unglück zu schweigen angesichts der genozidalen Verbrechen und der menschenrechts- sowie völkerrechtswidrigen Taten des Russischen Staates.
Als ob es um eine Konkurrenz des Leides ginge, um einen Vergleich, der durch eine gleichzeitige Präsenz ermöglicht würde. Dabei verbreitete sich der Vergleich wegen der Unklarheit der Grenzen von kulturellen Gemeinschaften unwillkürlich auch auf die Ukrainer, die in den besetzten Gebieten geblieben waren und aus unterschiedlichen Gründen ihre politische Position nur undeutlich äußerten.
Die Betroffenen, die mit dem Epizentrum des Verbrechens näher verbunden waren, hatten weniger Recht auf das kollektive Mitleid. Ganz im Gegenteil, sie sollten ihre eigene Mitverantwortung sehen und anerkennen. Und zu einem wesentlichen Teil dieser Anerkennung sollte die Unterbrechung ihrer Rede gehören. Ich spreche dabei auch über die Ukrainer, die von Kindheit an unterschiedliche Arten solcher Verbundenheiten praktizierten.
Die Grenzen einer solchen Mitverantwortung sind aber zu beweglich, um sie genau zu bestimmen. Auch das kollektive Mitleid (wie auch dessen Entzug), das in Medien und sozialen Netzwerken eine Form findet, braucht eine klarere Beschreibung. Ich spreche nicht über staatliche repressive Mechanismen, sondern über eine Beurteilung, eine zerstreute pointilistische Meinungsbildung, die sich in einer Welle von autorisierten kurzen Aussagen manifestiert. Indem sie einen anonymen common sense unterstellt, schafft sie erfolgreich die Illusion, von der ganzen Gesellschaft (Gemeinschaft, Land) unterstützt zu werden.
Wenn ich aber über diesen Aufruf zum Schweigen weiter nachdenke, frage ich mich: Wo liegen die Grenzen von kulturellen Gemeinschaften? Sind sie wirklich sprachlich bestimmbar, wie es vom russischen Staat seit 2014 behauptet wurde?
Nicht nur die ukrainischen Territorien sind okkupiert, ich selbst fühle mich okkupiert durch die Interpretation der politischen Bedeutung meiner Sprache. Die russischen staatlichen Medien operieren mit der Idee, dass die Sprache die kulturelle Zugehörigkeit bestimmt. „Russische Kultur“ als Begriff scheint angesichts dieses Krieges zu ungenau zu sein und als aggressive imperiale Idee sich zu entwickeln. Diese Idee funktioniert als eine sprachliche, kulturologische und politische gleichzeitig, sie hat populistische Züge und versucht ihre Ansprüche auf fremde Territorien durch die sprachlichen Verwandtschaften zu rechtfertigen.
Und diese Vision wird leider zu oft nicht dekonstruiert, sondern von großen Teilen der ukrainischen kulturellen Gemeinschaft geteilt.
Es entstehen weitere Fragen: Wie inszeniert sich eine Rede? Wie ein Schweigen?
In diesem Fall, wie in vielen anderen, ist das Schweigen nur dann zu bemerken, wenn es sich irgendwie zeigt.
Die neue Stufe des Krieges hat mich im Februar in Kiew erwischt. In meinem Facebook vermischten sich wie üblich die Stimmen aus vielen Ländern. Eine russische Feministin, Queer-Aktivistin, Redakteurin der Moskauer Kunstzeitschrift Colta, die Kunstwissenschaftlerin Nadeschda Plungian schrieb irgendwann im März (ich zitiere ihre Worte aus dem Gedächtnis): „Mein Facebook funktioniert schlechter und schlechter. Es ist blockiert und meine Versuche die Blockierung zu umgehen, missfallen, werden kritisiert. Colta ist verboten und hört auf zu existieren. Und ich will nicht mehr schreiben. Ich verschwinde in ein Schweigen und bin nicht sicher, dass ich hier demnächst erreichbar sein werde, ich nehme Abschied“.
Wütend beobachtete ich in jenen Tagen, wie meine gewohnte Welt unterging, Kiew wurde umzingelt und ich wusste nicht, was die nächste Stunde uns bringen würde, aber als ich Nadias Nachricht las, empfand ich eine tiefe Traurigkeit. Als ob ich selbst Nadia aufgefordert hätte, sich nicht zu äußern, sich nicht zu zeigen und sich angesichts von allem, was in der Ukraine passiert, von der gemeinsamen Öffentlichkeit zurückzuziehen oder noch radikaler – zu verschwinden.
Ich wollte ihr schreiben, sie überzeugen, dass ich ihre Einträge immer gerne gelesen habe und weiterhin lesen möchte. Dabei war ich nicht sicher, ob es nicht zu riskant für sie sein könnte, wenn sie in Moskau lebend frei ihre Meinung äußert.
Die Grenze zwischen unseren Ländern nahm in diesen Tagen solche Züge an, dass selbst eine virtuelle Gemeinsamkeit lächerlich erschien. Das andere Land, das Nachbarland war schon längst nicht mehr zugänglich, ja unerreichbar für mich, aber nach dem 24. Februar hat sich diese Kluft auf neue Weise manifestiert. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob ich für Nadia ein paar Worte fand an jenem Abend, ob ich ihr etwas erwidert habe. Jetzt denke ich, ich hielt mich zurück, weil ich mich zwischen unterschiedlichen Formulierungen und Intentionen für keine entscheiden konnte.
Heute am Abend telefonierte ich mit einem ukrainischen Soldaten. Er ist jünger als ich, befindet sich im Süden des Landes, in Nikolajev, wo auch seine Oma wohnt. Nikolajev gehört zu den am stärksten unter Raketenbeschuss geratenen Städten der Ukraine. Alle Universitätsgebäude, fast alle Schulen sind während dieser acht Kriegsmonate zerstört worden. Mit einer besonderen Betonung spricht er über die Internationale Klassische Universität Pylyp Orlyk, die er selbst absolviert hat. „Diese wunderschöne Universität, eine der besten im Lande, liegt in Ruinen. Alle Räume, die ich kenne, die ich besucht habe, sind wie von innen nach außen gekrempelt“ – sagte er.
Ich wollte ihn über seine täglichen Erfahrungen befragen. Schon mehrere Monate ist er an der Front.
Aber er fing selbst an vom Krieg zu erzählen, dessen Ursprung er in einem Tausendjährigen Konflikt sieht, der wieder und wieder zwischen Russland und der Ukraine aufflammt. „Nur so, - sagt er erbittert, - kann man das alles erklären. Unser größter Fehler war, dass wir alle diese Kriege vergessen und ihnen wieder geglaubt haben“. Darauf schweige ich eine Weile und frage ihn, was er um sich herum sieht. Ich möchte auch wissen, wie diese südliche, faule, langsame und melancholische Stadt ständige Raketenbeschüsse erlebt. Er sagt, als ob er auf eine ganz andere Frage antwortet, dass der Krieg schrecklich und nicht romantisch sei, und dass in keinem Buch, das er je las, das beschrieben wurde, was man dort jetzt erlebt. Der Krieg erzwingt keine Heroik, nichts Heldenhaftes, er bricht die Menschen einfach nur. „Ich bin ein Pessimist“, - meinte er. Aber das Leben ist so geblieben, wie es war. Die Menschen sind genauso melancholisch und langsam wie vor dem Angriff. Sie versuchen genauso wie früher, die Tage etwas mürrisch zu genießen. Über seine Oma erzählte er, dass sie jeden Tag um fünf Uhr morgens aufsteht, in einen Keller geht, eine Stunde wartet und danach wieder weiterschläft. Die Beschüsse finden fast täglich früh am Morgen statt.
Auf den Fotos von Nikolajev in meinen Telegramkanälen sehe ich zerstörte Wohnhäuser und Haltestellen. „Alle gehen wieder schlafen, nach dem Beschuss. Und niemand scheint sich große Sorgen zu machen, dass die Beschüsse manchmal fortgesetzt werden, obwohl Wohnhäuser attackiert werden. Immerhin versuchen die Menschen hier von der dritten, vierten und fünften Etage in die unteren zwei umzuziehen. Das ist die einzige ernsthafte Vorsichtsmaßnahme“. Der Krieg in Nikolajev ist zum ‚Alltagskummer‘ geworden, über getroffene Häuser spricht man in den Markthallen und an den Bushaltestellen. „Meistens passieren die Beschüsse in der nächtlichen Dunkelheit, und dann sucht man am nächsten Tag nach den Menschen in den Trümmern. Acht Mal haben wir es erlebt, dass im Tageslicht die offenen Haltestellen getroffen wurden. Nur acht Mal während des Krieges. Darüber reden wir aber irgendwann später oder gar nicht“.
Ich schreibe seine Worte auf, kann sie aber nicht kommentieren. Ich stelle mir nur die Aussage eines anderen Menschen vor als einen Kommentar.
In Kiew war es heute dunkel, keine Elektrizität und kein Wasser in vielen Bezirken, dann gab es doch wieder Licht, aber nur für wenige Stunden. Die absolut dunklen, beinahe schwarzen Straßen, so habe ich es in Kiew früher während des Krieges erlebt, sollten wie eine Erweiterung der Stadt, eine Einweihung in eine neue unbekannte Architektur aussehen. Man entdeckt, wie stark nächtliche Beleuchtung die Vertrautheit der Umgebung beeinflusst und sie aufrechterhält.
„Sie kamen und sagten: Tötet uns! Oder wir werden euch töten. Nicht nur töten – die Häuser und Städte ruinieren, rauben und vergewaltigen. Und ihr – wie ihr wollt. Wir haben für alle Fälle schon mal angefangen.“
Das hat mein Freund, der Historiker Kyrylo Tkachenko halb scherzhaft in einem Gespräch mit mir formuliert. Es klingt wie eine Behauptung, aber eigentlich es ist eine Frage, die nichts Theoretisches in sich birgt, sondern praktisch an sehr viele Ukrainer gerichtet wurde.
Der Soldat, mit dem ich manchmal rede, sollte eigentlich nach seinem Universitätsabschluss und seiner Ausbildung ein Soziologe und Übersetzer werden, ist aber im Laufe des Krieges zum professionellen Soldaten geworden.
Die Gewalt, die Millionen von Menschen in der Ukraine zu Augenzeugen der Kriegsverbrechen macht, und die zu einer Totalität für die Ukrainer geworden ist, wird vom Aggressor wieder und wieder und stets auf andere Weise theoretisch gerechtfertigt. Neben den ständig andauernden Verbrechen entstehen Evereste von Propaganda, irrationale, fantasiereiche Beschreibungen, warum dieser Krieg für Russland so notwendig und so unabwendbar war. Warum man nur sterben, ermordet werden und zuschauen soll, wie alles, was man seit der Kindheit geliebt und geschätzt hat, ermordet wird, oder selbst morden soll und sich dadurch schützen.
Aber man will sich, auch wenn es praktisch beinahe keine Wahl zu geben scheint, theoretisch von dieser Fragestellung trennen, sich abgrenzen.
Vor unseren Augen entstehen Identitäten, deren Ziel es ist, nicht etwas oder jemanden zu beschreiben, sondern jemanden auszuschließen, sich durch Verneinung zu definieren. Viele Ukrainer wechseln ihre Sprache, um nicht von der russischen Propaganda als „Russen“ definiert zu werden. Es existiert zu wenig Verständnis für die grauen Zonen der Gesellschaft, für die politische Unentschiedenheit, für die Regionen der Ukraine, die früher sogar bewundert waren, weil sie sich multikulturell sich entwickelten.
Diese Tendenz geht, so denke ich, meistens in eine falsche Richtung. In den Netzen der verzweifelten und radikalen Beschuldigungen verfangen sich nicht die Verbrecher oder diejenigen, die das Verbrechen unterstützen. In diesen Netzen werden fast nur die gefangen, die bereits eine Schuld empfinden, die vielleicht schon lange mit dieser Schuld lebten und selbst vergeblich gegen das gleiche Verbrechen gekämpft haben.
Die Web-Kameras eines ukrainischen Kurators aus der Oblast Luhansk, Dmytro Chepurny, dokumentieren automatisch, wie ins Haus seines Onkels eingebrochen wurde. Der Onkel hat Luhansk im Februar verlassen. Er liebte sein Haus, seine Erinnerungen, seine Umgebung so sehr, dass er während der Okkupation in 2014 in Luhansk blieb und versuchte, diese Jahre mit seiner kleinen Rente durchzukommen.
Ein Paar Soldaten brechen die hohe eiserne Pforte im Zaun, sie gehen durch den Hof, schauen sich um, sie lächeln etwas frech, als ob sie einander ermutigen wollen, so eine Kleinigkeit wie eine Hausplünderung zu unternehmen angesichts der Kriegsverbrechen in der Ukraine. Die Wifi-Kamera fixiert, wie diese Menschen rein und rausgehen, als ob sie etwas gefunden und verstanden haben. Es vergeht ein Tag. Dann ist die Kamera, die auf die Bewegung automatisch reagiert, wieder an, sie zeigt, wie dreißig russische Soldaten in diesem Einfamilienhaus stationiert werden. Ein Auto fährt zum Zaun, es werden Kisten hineingetragen. Die Aufnahme ist schwarz-weiß, die Auflösung schlecht, die Männer sehen wie Gespenster aus, wie ein lebendiges Zitat aus einer anderen Epoche. Ein Zitat, dass in diesem Text nicht bleiben soll, weil es nicht hingehört. Man sieht, dass diese Gespenster scherzen und versuchen, ihren rotzigen Habitus auszustellen. Endlich bemerkt einer der Soldaten die Kamera. Ich sehe seine Hand, die sich nähert. Die Aufnahme bricht ab.
So wurden diese fremden bewaffneten Menschen von den Eigentümern des Hauses entdeckt, sie zeigten sich kurz bei ihrem Einzug und dann verschwanden sie wieder aus der Sicht. Vielleicht sind Sie jetzt dort, im Haus, trinken aus den Tassen, die in dem alten Schrank standen und so manches über die Geschichte der Familie meines Freundes verraten konnten. Sie haben niemanden um Erlaubnis gefragt und bis jetzt wurde kein Rechtsmittel gefunden, sie zu zwingen, dieses Haus, das ihnen nicht gehört, zu verlassen.
Mit diesem Beispiel, und zahllosen anderen Vorfällen, soll dieser Krieg meiner Gesellschaft beibringen, dass sämtliche früheren Lebensregeln außer Kraft gesetzt sind, dass es kein Gesetz mehr gibt. Die Werte, die Weltordnung, die wir kannten, die von Kindheit an sorgfältig, zuerst durch Märchen und Spiele einem Menschen langsam beigebracht wird, gibt es nicht mehr. Und an die Stelle dieser großen Abwesenheit des Gesetzes – für die es keine ernst zu nehmende Erklärung gibt – ist nur ein Wahn, nur eine Propaganda getreten. Sie funktioniert wie eine Kombination von Leerstellen, die willkürlich, reaktiv mit neuen Begriffen, Worten und radikalen Emotionen gefüllt werden.
Mein Vater, Literaturübersetzer (aus dem Deutschen - von Paul Celan bis Ilse Aichinger und anderen), nennt diese Abwesenheit in seinem letzten noch nicht veröffentlichen Text „Totes Imperium“. Ein Imperium, das nicht mehr lebt und nicht leben kann, schlägt, mordet im Namen seiner unmöglichen Wiederkehr.
Aber hinter dieser Konzeption verbirgt sich nicht ein Kollektiv, das keine Grenzen hat und von außen beschrieben und verurteilt werden soll, sondern eine Idee, die allem Anschein nach auch keine klare Form hat. Diejenigen aber, die diese Idee unterstützen, können entdeckt werden, wie die Soldaten auf der Videoaufnahme meines Freundes, sie zeigen sich auf diese oder jene Weise. Wenn man sich so einen materiellen Beweis ansieht, muss man keine Gemeinschaft mehr ausdenken, um zu verstehen, mit wem man kämpft, wer uns vor die Wahl stellt: sich zu schützen, zu morden, oder selbst ermordet zu werden.
Und dennoch: immer wieder in diesem Krieg beobachte ich, wie etwas spricht, zeugt, entblößt und verurteilt und viel lauter wird, als eine menschliche Stimme.
Es sind die Tätowierungen auf dem Körper. Nur ein Beispiel. Wenn ein Einwohner von Mariupol nach Russland fahren wollte, um seine entfremdeten Kinder zu holen, musste er ins Filtrationslager. Er sollte sich ausziehen, sein Körper wurde wieder und wieder untersucht, ob er nicht vielleicht Zeichen trägt, dass dieser Mann die Ukraine unterstützt.
Es sind Chor-Gesänge. Die Menschen in den Filtrationslagern in den besetzten Gebieten werden wieder und wieder gezwungen, die Hymne von Russland oder die der separatistischen Republiken zu singen. Sie werden gefilmt, die Videos werden verbreitet, damit diese Menschen in der Ukraine unter Verdacht geraten.
Es ist die Sprache selbst. In den Texten meiner KollegInnen aus der Ukraine lese ich manchmal, dass die russische Sprache in sich die Propaganda und die Verbrechen des heutigen Russland trägt, und wer sie spricht und schreibt, würde von den Verbrechen infiziert, unwillkürlich und unvermeidbar, ohne sich davon distanzieren zu können.
Die Ukrainische Sprache in den besetzten Gebieten wird zum Vorwand für Foltern und Todestrafen.
Es ist eine Staatsangehörigkeit. In diesem Krieg spricht die Staatsbürgerschaft eines Menschen oft überzeugender, lauter, als seine oder ihre Taten und Weltanschauungen.
Es ist die Geschichte der Gesellschaft, der Literatur, die durch die Tatsachen dieses Krieges neu interpretiert werden, als ob die Autoren aus dem 19 Jahrhundert jetzt mitkämpfen.
Sogar in dieser kleinen Aufzählung sieht man eine riesige Diskrepanz in den Dimensionen der Gewalt. Russland vernichtet das Leben, vernichtet Gemeinschaften und Erinnerungen und die Ukraine sucht eine Antwort auf die russische Propaganda.
Der Geburtsort, frühere Lebensorte, die Ausbildung, der Körper, die Aussprache – das scheint den Redenden in einer bestimmten Identität zu fixieren, mit solch einer aussagekräftigen Gewalt, dass seine eigentliche Sprache und seine Rede fast die Bedeutung verlieren.
Durch die Gitter der festen aggressiven Perzeption sehe ich versäumte Gelegenheiten in vielen Sprachen und Stimmen, die ich vermisse.
November-Dezember 2022