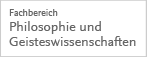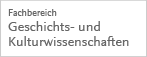Aktuelle Lehrveranstaltungen (werden als FSGS-Seminare anerkannt)
Seminare im Sommersemester 2025
Seminar: “The Aesthetics and the Politics of Collapse” (Bereiche: Literatur und Wissen; (Inter-)Medialität und die Künste)Leitung: Caroline Kögler & Nina Tolksdorf
Format: Präsenz
Zeit: Montag
Ort: Raum 00.05 im EXC Temporal Communities, Otto-von-Simson-Straße 15, 14195 Berlin
LV-Nummer:16583
Das Seminar findet in englischer Sprache statt.
Class dates:
- 1 | Montag, 14. April, 10–12 Uhr
- 2 | Montag, 5. Mai, 9–18 Uhr
- 3 | Montag, 19. Mai, 9–18 Uhr
- 4 | Montag, 26. Mai, 9–16:30 Uhr
Building on Jack Halberstam’s recent work on “collapse,” “un/worlding” and queer theory, this masterclass engages with the topic of “collapse” in relation to “deep time.” Focussing on long time spans, we ask how these render visible or produce collapse, how collapse can be read as a symptom of deep time, how collapse may reveal traces of unregistered or unfathomable histories, and how the nexus itself intersects with both human and non-human processes (from politically produced or framed to environmental processes). In relation to literary and cultural productions, we explore the aesthetics and the politics of deep time and how they relate to the formation of communities. How do traces of deep time and/as collapse shape communities and their material practices? How do traces of deep time affect communities or community narratives, or call for their adjustment?
Registration until April 1, 2025 through email to masterclass@temporal-communities.de
Link zur Veranstaltung im Vorlesungsverzeichnis.
Seminar: Wunderbares und Wissen (Bereich: Literatur und Wissen)
Leitung: Jutta Eming
Format: Präsenz
Zeit: Dienstag, 14–16 Uhr
Ort: JK 26/101
LV-Nummer:16652
Die Formulierung des Aristoteles, dass Verwunderung den Anfang der Philosophie bildet und Menschen kein Wissen erworben, wenn sie sich nicht zunächst gewundert hätten, gehört zu den viel zitierten Leitsätzen über wissenschaftliche Erkenntnis in den Geisteswissenschaften. Seltener geht es um die Frage, welches Verhältnis von Verwunderung und Wissen dabei impliziert ist. Bei Aristoteles ist es umgekehrt proportional: Wenn der Gegenstand, welcher Fragen aufwirft, erforscht ist, tritt Wissen an die Stelle von Verwunderung.
Das Seminar setzt bei der Prämisse an, dass ein solches Ausschlussverhältnis für einen zentralen Bereich der Vormoderne nicht angesetzt werden kann: für das Wunderbare in literarischen Texten des Mittelalters und der Frühen Neuzeit. In den bekanntesten ebenso wie in weniger bekannten Dichtungen vertreten Rhetoriken und Narrative über das wunder und über das, was wunderlîche ist, auf verschiedenen literarischen Ebenen Wissen. Monstra, Automaten und künstliche Menschen, Feen und Zauberer, Riesen und Zwerge, magische Objekte oder Sonderbezirke und Anderswelten werfen für literarische Protagonisten, Erzähler und Rezipient:innen Fragen auf, fordern ihre Wissensbestände heraus und erweitern sie zugleich. Auch die theologische Auffassung, dass die Wunder der Natur – als Wunder der Schöpfung – eine Form der Erkenntnis Gottes darstellen, wird damit produktiv verknüpft. Das Seminar verfolgt diese Vielfalt chronologisch und gattungssystematisch für zentrale literarische Texte zwischen 1200 und 1600.
Link zur Veranstaltung im Vorlesungsverzeichnis.
Seminar: Frauenfiguren im Parzival (Bereich: Literatur als Textpraxis)
Leitung: Jutta Eming
Format: Präsenz
Zeit: Mittwoch, 10–12 Uhr
Ort: JK 31/101
LV-Nummer: 16688
Der Parzival des Wolfram von Eschenbach gilt als einer der – auch sprachlich – anspruchsvollsten und komplexesten höfischen Romane der ‚klassischen‘ höfischen Literatur. Im Seminar soll der Text konsequent aus der Perspektive der Frauenfiguren gelesen werden, die Parzival (und seinem Vater) auf dem Weg durch den Roman begegnen oder zu ihm in eine Beziehung treten. Dazu gehören die dunkelhäutige Herrscherin Belakane, mit der Parzivals Vater Gahmuret einen ersten Sohn zeugt, Parzivals Cousine Sigune, die um ihren Geliebten trauert, oder die Magierin Cundrie, die ihm, scheinbar auf dem Höhepunkt seiner ritterlichen Laufbahn, schwere Vorwürfe macht, die ihn in eine Krise stürzen, und viele mehr. Im Seminar soll ihre Rolle im Roman mit Ansätzen der Gender Studies und der Intersektionalitätsforschung erschlossen werden. Dafür wird die De Gruyter-Studienausgabe des Parzival zugrunde gelegt.
Link zur Veranstaltung im Vorlesungsverzeichnis.
Seminar: Früher Buchdruck (Bereich: Literatur als Textpraxis)
Leitung: Jutta Eming
Format: Präsenz
Zeit: Mittwoch, 14–16 Uhr
Ort: JK 31/101
LV-Nummer: 16689
Das Seminar möchte in die Produktions- und Rezeptionszusammenhänge eines Mediums einführen, welches den Literaturmarkt ab der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts grundlegend umgestalten wird: den Buchdruck. Zu Beginn noch ähnlich prestigeträchtig und kostspielig wie das ältere Medium der Handschriften, entwickelt sich der Buchdruck bald zu einem Literaturträger mit ganz eigenen Bedingungen und Möglichkeiten. Dies soll im Seminar an einigen ‚Bestsellern‘ der Epoche, der Melusine Thürings von Ringoltingen und den Sieben weisen Meistern, nachvollzogen werden. Dazu ist auch eine Zusammenarbeit mit der Staatsbibliothek und die Besichtigung einiger Exemplare vor Ort vorgesehen.
Link zur Veranstaltung im Vorlesungsverzeichnis.
Seminar: Theater, Drama, Autorschaft: Elfriede Jelinek (Bereich: Literatur, (Inter-) Medialität und die Künste)
Leitung: Anne Fleig
Format: Präsenz
Zeit: Dienstag, 8.30–10 Uhr
Ort: JK 29/124
LV-Nummer: 16716
Keine Autorin hat das deutschsprachige Theater mit ihren Texten und ihrer Programmatik so sehr verändert wie Elfriede Jelinek. Seit den frühen 1980er Jahren schreibt die Literaturnobelpreisträgerin für die Bühne. Die immer neue Hinwendung zur Öffentlichkeit, die Auseinandersetzung mit brisanten politischen Themen und das Schreiben „Im Abseits“ (2004) stehen dabei in einem anhaltenden Spannungsverhältnis. 1989 postulierte sie: „Ich will kein Theater. Ich will ein anderes Theater.“ Wie der Streit um dieses andere Theater ihre Texte und insbesondere ihre Positionierung als Autorin geprägt hat, soll im Zentrum der gemeinsamen Arbeit stehen. Das Seminar möchte in einem großen Bogen von den frühen Stücken bis hin zu aktuellen Texten die Entwicklung von Jelineks dramatischem Werk nachvollziehen. Einbezogen werden auch essayistische Texte der Autorin sowie Texte zur Dramentheorie und Postdramatik.
Die Stücke sind teils auf Jelineks Homepage, teils in Taschenbuchausgaben erhältlich. Bitte verschaffen Sie sich einen ersten Überblick über Leben und Werk anhand der überarbeiteten Ausgabe des Jelinek-Handbuchs (Hg. von Pia Janke; 2024).
Link zur Veranstaltung im Vorlesungsverzeichnis.
Seminar: Texte, Bilder, Embleme: Petrarcas Canzoniere und seine ‚Illustrationen‘ (Bereich: Literatur als Textpraxis)
Leitung: Bernhard Huß
Format: Präsenz
Zeit: Montag, 14–16 Uhr
Ort: JK 31/124
LV-Nummer: 17051
Francesco Petrarca hat mit seinem Canzoniere das vermutlich wirkungsmächtigste Lyrikbuch der europäischen Literatur verfasst. Zugleich ist dies das erste Werk der italienischen Literaturgeschichte, das uns in einem materiellen Zustand vorliegt, den der Autor selbst verantwortet, nämlich in der Handschrift Vaticanus latinus 3195 mit dem gesamtem Text des Canzoniere. Petrarcas Lyrikbuch hat in der Frühen Neuzeit nicht nur zahlreiche imitationes nach sich gezogen, sondern auch zur Tendenz einer bildkünstlerischen Emblematisierung der Literatur beigetragen und wurde selbst des Öfteren mit Illustrationen versehen. Im Seminar soll der Canzoniere unter Berücksichtigung seiner materialen Textgestalt interpretiert werden, um im Anschluss daran die wichtigsten Dimensionen der Relation von lyrischem Text und bildlichen Darstellungen herauszuarbeiten.
Ausreichende Kenntnisse des Italienischen sind notwendig.
Link zur Veranstaltung im Vorlesungsverzeichnis.
Seminar: Das goldene Zeitalter von der Arcadia bis zu Leopardi: utopische Welten und politische Kritik (Bereich: Literatur und Wissen)
Leitung: Bernhard Huß
Format: Präsenz
Zeit: Montag, 12–14 Uhr
Ort: KL 29/110
LV-Nummer: 17052
Beim ‚Goldenen Zeitalter‘ handelt es sich um einen aus der Antike stammenden Topos, der die jeweilige Gegenwart der Menschen mit einer mythisch verklärten, ‚goldenen‘ Phase der Vergangenheit kontrastiert, in der soziale, politische und physische Eintracht und Unversehrtheit geherrscht haben sollen, eine Art paradiesischer Gesellschaftszustand, gegen den sich das Unheil der Jetztzeit negativ abheben lässt. Wir wollen uns im Seminar nach einem einführenden Blick auf die Ursprünge dieser Vorstellung auf das 18. und das frühe 19. Jahrhundert in Italien konzentrieren, also den Übergang von der ‚Aufklärung‘ zur ‚Romantik‘ (nicht ohne die Ergiebigkeit dieser Epochenbegriffe kritisch zu beleuchten). Im Fokus steht für das 18. Jahrhundert die literarische und kulturelle Ideologie der römischen Accademia dell’Arcadia (1690 gegründet und bis heute bestehend), für das frühe 19. Jahrhundert das philosophische Denken und die literarischen Texte von Giacomo Leopardi. Zentral wird die Frage sein, welche Rolle das ‚Goldene Zeitalter‘ im jeweiligen Kulturentwurf zu spielen hat. In das Seminar integriert ist ein Gastauftritt des derzeitigen Leiters (Custode) der Arcadia, Prof. Maurizio Campanelli.
Ausreichende Kenntnisse des Italienischen sind notwendig.
Link zur Veranstaltung im Vorlesungsverzeichnis.
Seminar: Michel de Montaigne als Leser (Bereich: Literatur als Textpraxis)
Leitung: Anita Traninger
Format: Präsenz
Zeit: Dienstag, 12–14 Uh
Ort: J 23/16 Übungsraum
LV-Nummer: 17015
Link zur Veranstaltung im Vorlesungsverzeichnis.
Seminar: Mythology from the Sumerians to the Presocratics I (Bereiche: Literatur und Wissen; Literatur als Textpraxis)Leitung: Cale Johnson und Gösta Gabriel
Format: Präsenz
Zeit: Donnerstag, 10–12 Uhr
Ort: Raum 010, Arnimallee 10
LV-Nummer: 13994
This seminar looks at the broad history of written myth, ranging from southern Mesopotamia in the third millennium BC, through the Hurro-Hittite and Ugaritic myths, to their earliest manifestations in Greek myth. This course focuses in particular on how myths are transformed and interpreted as they pass from one culture or written tradition into the next, on the origins of commentary traditions in text and image, and on whether or to what extent modern theories of mythology can contribute to our understanding. Each seminar meeting will combine lecture, discussion and reading of ancient mythical sources in English translation. The course will be taught chronologically over two semesters, so students are strongly encouraged to take both courses as part of a single module. This course will be taught in English, 2 hours per week.
Link to the seminar in the FU course catalogue.
Seminar: Infrastruktur: Theorie und Praxis eines Kulturobjekts (Bereich: Literatur, (Inter-)Medialität und die Künste)
Leitung: Susanne Strätling
Format: Präsenz
Zeit: Mittwoch, 9–12 Uhr
Ort: KL 29/110
LV-Nummer: 16461a
Obwohl Infrastrukturen in der Regel mit konkreten baulichen Anlagen, die sich oft weit in den Raum hinein erstrecken, einhergehen, bleiben sie eigentlich abstrakt. Das liegt nicht nur daran, dass sie als kritische Infrastruktur; besonders geschätzt werden und oft unterirdisch oder unterseeisch im Verborgenen verlaufen. Es liegt auch daran, dass die Aufgaben von Infrastrukturen so divers sind vom Aufbau öffentlicher WLAN-Hotspots (oder historisch: mit Telefon) die Versorgung von Kommunen mit Kanalisationssystemen bis hin zur Zirkulation von Werten im globalen Banken- und Börsensystem. Ausrangierte Infrastrukturen der industriellen Moderne werden zudem gerne zur Behausung von Kunst- und Kultureinrichtungen zweckentfremdet und/oder zum UNESCO-Weltkulturerbe. Schaut man auf die Begriffsgeschichte der Infrastruktur, so stellt man fest, dass Infrastrukturprojekte an der Durchsetzung der Moderne mitbauen. Sie sind wesentliches Instrument der Vernetzung von Subjekten, der Übertragung von Information, der Verflechtung von Räumen, der Technisierung von Lebenswelten und der Normierung von Erfahrung. Dabei agieren sie bisweilen wie Medien, die trotz ihrer materiellen Gegebenheit die ihnen zugewiesenen Übermittlungsaufgaben möglichst geräuscharm im Hintergrund erledigen sollen. Im Seminar beleuchten wir dieses Funktionsspektrum von Infrastrukturen in historischer und systematischer Perspektive. Dabei werden wir uns eingangs eine Übersicht über die bestehende Forschungsliteratur verschaffen und anschließend am Leitfaden von Fallbeispielen versuchen, diese Forschung in Richtung einer Kultur- und Medientheorie der Infrastruktur auszudifferenzieren. Ein thematischer Schwerpunkt des Seminars liegt auf Energieinfrastrukturen, ein regionaler Schwerpunkt auf dem Raum des östlichen Europas. Dabei geraten so unterschiedliche Infrastrukturen wie (gesprengte) Pipelines und Staudämme, (explodierte) Kernkraftwerke oder (gekappte) Kabelstränge in den Blick. Wie gehen jedoch thematisch wie räumlich; je nach Interessenslage der Teilnehmenden über diese Schwerpunkte hinaus. Zur Forschungsagenda des Seminars gehört auch, Feldforschung zu betreiben und Infrastrukturen in ihrer materiellen Gegebenheit in Augenschein zu inspizieren. Mitte Juni werden wir deshalb eine Exkursion zum Petrolchemischen Kombinat nach Schwedt, dem Standort eines zentralen Infrastrukturprojekts der fossilen Deutsch-Russischen Freundschaft; vor der Zeitenwende, unternehmen. Das Seminar findet wöchentlich von 10-12 Uhr statt. Die dritte LV-Stunde setzen wir für die o.g. Exkursion ein. Für die Bescheinigung der aktiven Teilnahme übernehmen Sie die Erarbeitung und Präsentation eines selbstgewählten Fallbeispiels. Dies kann auch in Gruppenarbeit erfolgen.
Link zur Veranstaltung im Vorlesungsverzeichnis.
Seminar: Kants Theorie des Schönen (Bereich: Literatur und Wissen)
Leitung: Dina Emundts
Format: Präsenz
Zeit: Montag, 10–12 Uhr
Ort: JK 29/118
LV-Nummer: 16071
In dem Seminar werden wir uns mit Kants Theorie des Schönen auseinandersetzen. Diese Theorie war sehr einflussreich und sie ist bis heute aktuell und viel diskutiert geblieben. Unser Hauptbezugstext wird der erste Teil von Kants Kritik der Urteilskraft (1790) sein. Kenntnisse der Philosophie Kants oder/und in der Geschichte der Ästhetik sind willkommen, aber keine Voraussetzung. Wir werden uns vor allem mit Fragen beschäftigen, die man gut am Text diskutieren kann: Was ist für Kant ein ästhetisches Urteil? Was meint er, beispielsweise, mit interesselosem Wohlgefallen? Was sagt Kant über den Unterschied von Schönem und Erhabenen? Welches Verhältnis haben Natur- und Kunstschönheit?
Link zur Veranstaltung im Vorlesungsverzeichnis.
Seminar: Schreibweisen der Gegenwart: Auto – Theorie – Fiktion (Bereiche: Literatur als Textpraxis; Literatur in transnationaler Perspektive)
Leitung: Jutta Müller-Tamm und Julia Weber
Format: Präsenz
Zeit: Donnerstag, 12–14 Uhr
Ort: JK 33/121
LV-Nummer: 16713
Das gemeinsame Seminar von Jutta Müller-Tamm (Neuere deutsche Literatur) und Julia Weber (Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft) widmet sich dem aktuellen Interesse an autotheoretischen Erzählweisen, die persönliche Erfahrungen und theoretische Reflexionen innovativ verknüpfen. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Theorie nicht nur als analytisches Werkzeug eingesetzt, sondern als kreatives Material genutzt wird, das – in Verschmelzung mit ästhetischen Schreibstrategien – alternative Perspektiven auf gesellschaftliche Normen, Wissensordnungen und literarische Selbstkonstitution eröffnet. Neben den weithin bekannten Vertreter:innen autotheoretischer Schreibweisen wie Chris Kraus, Paul B. Preciado und Maggie Nelson, die zu den einflussreichsten Stimmen autotheoretischen Erzählens zählen, möchten wir auch Werke von deutschsprachigen Autor:innen einbeziehen, die vielleicht (noch) nicht explizit unter dem Label der Autotheorie verhandelt werden, deren Texte jedoch ebenfalls durch die Verbindung von subjektiver Erzählung und theoretischer Reflexion sowie fiktionaler und faktualer Anteile gekennzeichnet sind, etwa Dorothee Elmiger oder Frank Witzel. Das Seminar lädt dazu ein, die Möglichkeiten und Grenzen autotheoretischer Erzählweisen differenziert zu betrachten. Dabei sollen nicht nur ihre innovativen Potenziale gewürdigt, sondern auch problematische Aspekte, wie etwa die Zentralstellung persönlicher Erfahrungen oder die Gefahr der Vereinfachung komplexer theoretischer Diskurse, kritisch hinterfragt werden. Ziel ist eine differenzierte Auseinandersetzung, die auch die gesellschaftlichen und politischen Implikationen autotheoretischer Erzählweisen in den Blick nimmt.
Link zur Veranstaltung im Vorlesungsverzeichnis.
Seminar: Theoriestile (Bereiche: Literatur und Wissen; Literatur als Textpraxis; Literatur in transnationaler Perspektive)
Leitung: Michael Gamper
Format: Präsenz
Zeit: Montag, 12–15 Uhr
Ort: KL 29/207
LV-Nummer: 16460
Seit einigen Jahren beansprucht Theorie; Aufmerksamkeit als eigenes Textgenre, das zwar an konkreten Gegenständen und in spezifischen Fächern entwickelt wird, aber allgemeine Einsichten und interdisziplinäre Wirkungen hervorbringt. Dabei ist festzustellen, dass diese Theorie-Entwicklungen seit den 1960er Jahren prononciert Raum geben für die Ausprägung von eigenständigen und eigenwilligen Ausdrucksformen, die unverkennbare individuelle und gruppenspezifische Stilmerkmale hervorbringen, die zum Thema dieses Seminars gemacht werden sollen. Theoriestil; zielt zunächst auf die Analyse einer dezidierten und spezifischen Schreibweise von Theorie, aber auch auf die editorischen Praktiken von Zeitschriften und Gruppenpublikationen, die maßgeblich zur Institutionalisierung von theoretischen Schulen beitragen konnten. Ebenso im Fokus stehen Argumentationsstile, also die spezifische Verknüpfung von Elementen der Theoriekonstitution, sowie, und in direktem Zusammenhang damit stehend, eigenwillige und voneinander unterscheidbare Weisen der intellektuellen Ausprägung von Theorie; man könnte hier in Anlehnung an Ludwik Fleck auch von Denkstil sprechen.
‚Stil‘ interessiert so als Eigenheiten der Schreibweise von einzelnen Theoretiker:innen und theoretischen Strömungen, ein besonderes Augenmerk soll aber darauf gelegt werden, wie diese verschiedenen Stilaspekte die Zirkulation von Theorien beeinflussen. Orientiert ist die Tagung damit hin auf die Beweglichkeit und Dynamik der Theorie sie fragt nach den Transfers, Übertragungen und Zirkulationen der Stileigenheiten sowie nach der Rolle der verschiedenen Stilaspekte, Text- und Publikationsformen für diese Bewegungen. Der Aufbau des Seminars sieht vor, dass wir uns zunächst mit bestehenden Forschungsansätzen und exemplarischen Fallanalysen beschäftigen; geplant ist die Vorbereitung auf und Teilnahme an der Tagung Theoriestile: Schreibweisen, Denkfiguren, Zirkulationsformen (18.-20.6./FU Berlin); abgeschlossen wird das Seminar mit einem Workshop, an dem wir eigene Analysen diskutieren.
Literaturhinweise:
- Jonathan Culler, Kevin Lamb (Ed.): Just being Difficult. Academic Writing in the Public Arena, Stanford 2003.
- Ivan Callus, James Corby, Gloria Lauri-Lucente (Ed.): Style in Theory. Between Literature and Philosophy, London, New York 2013.
- Michael Eggers, Adrian Robanus (Hrsg.): Topik der Theorie. Zur rhetorischen Struktur der Theorie nach deren proklamiertem Ende, Berlin 2023.
Link zur Veranstaltung im Vorlesungsverzeichnis.